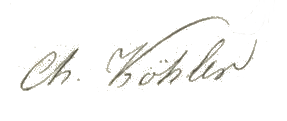Die Poesie

Beschreibung
Provenienz:
Ursprünglich im Besitz des Herrn Floh, Crefeld
Schenkung an Kunstmuseen Krefeld durch C. W. Crous (1892)
Ausstellungen:
Kaumueum Magdeburg, Halberstadt und Halle (1838)
Münchner Allgemeine Ausstellung (1858)
Pariser Ausstellung, Medaille 3. Klasse (1839)
Quellenhinweise
Geschichte der neueren deutschen kunst..., Band 3 von Atanazy Raczyński (hrabia), 1841
"Die allegorische Figur der Dichtkunst, von Köhler, ist nicht grau in grau entworfen. Sie wird allgemein sehr schön gefunden: ich finde mich jedoch nicht geneigt, sie zu loben; denn weder die Körperhaltung, noch die Bewegung des Kopfes, haben mir von guter Wirkung geschienen. Von dieser Poesie erwarte ich nimmer liebliche Verse."
Zürich und die wichtigsten Städte am Rhein mit Bezug auf alte und neue Werke (1843)
die Poesie, eine in den Wolken thronende Einzelfigur
Düsseldorfer Künstler aus den letzten fünfundzwanzig Jahren: kunstgeschichtliche Briefe (1854)
... eine allegorische Poesie nenne ich nur beiläufig, weil sie nur durch ihre Farbe interessant waren.
Geschichte der neuen deutschen Kunst. 2 (1863)
An keinem Bilde tritt das Bedenkliche der Düsseldorfer Prinzipien deutlicher hervor als an seiner „Poesie“. Ohne ursprüngliche Konzeption, ohne innere Anschauung wird eine Idee als solche gewiss nicht zur Darstellung gelangen; das Ausgehen vom Modell wird immer nur im besten Fall zu einer gut gezeichneten und wohlgemalten Figur führen. Das ist Köhlers „Poesie“, aber als Poesie die Reflexion in jedem Zuge, die den Ausdruck berechnet, die Silbenmaße zählt, vor Verletzung des Anstandes sich bewahrt, aber nicht mehr Begeisterung hat, als sich lernen lässt.
Die deutsche Kunst in unserem Jahrhundert: eine Reihe von Vorlesungen mit erläuternden Beischriften. 1 (1857) von A. Hagen
Er erfindet mehr in der ruhigen Breite; das gilt auch von seinen Bildern mit einer und zwei Figuren. Eine Überlegtheit gibt der Poesie einen sicheren Grund, und selbst eines seiner Werke „Die Poesie“ ist eine solche, die nicht von der Begeisterung emporgetragen wird, sondern die auf Wolken thronend aufzeichnet, was der Gott ihr in den Busen haucht. (Gestochen von J. Felsing 1840)
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte (1895)
Die Poesie. Allegor. Gestalt. (1838). Durch d. KV. f. Rh. u. W. an Commerz.-R. Floh, Crefeld. Jetzt Eigentum des Museums-Vereins. Gest. von J. Felsing. gr. fol. KV.-Bl. f. Rh. u. W. 1841. – KA. Magdeb., Halberst., Halle u. Braunschw. 38; Münch. allg. d. u. hist. 58.
Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst, insbesondere im XIX. Jahrhundert (1902)
... durch eine gewisse Kraft der Farbe, welche auch die stark Rafael nachempfundene ‚Poesie‘ 1838 aufzuweisen hat.
... und die „Poesie‘‘ 1841 von Felsing, ebenfalls als Nietenblatt für den Kunstverein gestochen.
Die Königliche Kunst-Akademie zu D.: ihre Gesch., Einrichtung und Wirksamkeit und die D. Künstler (1856)
„die Poesie“ (1838), durch den Kunstverein für Rheinland und Westphalen in den Besitz des Hrn. Floh in Crefeld übergegangen, (gestochen von Felsing)
Revue artistique et littéraire (1861) von Auvray, Louis (1810-1890). Directeur de publication
Die Poesie (diese Komposition wurde auf der offiziellen Pariser Ausstellung 1839 gezeigt)
Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819 – 1918 (2011) von Baumgärtel, Bettina
Die Poesie 1838
Öl auf Leinwand, 195,5 x 135 cm
Kunstmuseen Krefeld, Inv. Nr. 1892/22
Prov.: 1892 Schenkung C. W. Crous, Krefeld
Lit.: Püttmann 1839, S. 73; Hörisch 1979, S. 46 Abb. 18; Jansen 2010, S. 170-171, Abb. 2
Christian Köhler wählt für seine Poesie jenen Moment göttlicher Inspiration, in dem seine auf Wolken sitzende Personifikation kurz innehält und ihr Haupt gen Himmel wendet, bevor sie mit dem Griffel ihre Gedanken niederschreibt. Köhlers fast monumental wirkende Figur steht in der Tradition reniesker und raffaelesker Musenverklärung. Das Gemälde wurde schon zu Lebzeiten von hegelianischen Kunstkritikern wie H. Püttmann als „lächerlicher Versuch, das Unwesentliche in körperliche Formen zu zwängen“ und damit als „unverständliche Spielerei“ kritisiert. Es wurde als ein Indiz für die Krise der Malerei gewertet, da sich „große Gedanken“ ohnehin nicht in ein Bild bannen ließen. Trotz der zunehmenden Kritik nicht allein an Köhlers Kunst, sondern generell an der Kunst der Nazarener, fiel das Urteil über den Künstler selbst im Ausland ausgesprochen positiv aus, zuletzt auch in einem in Frankreich verfassten Nekrolog, als Köhler plötzlich in Montpellier verstarb. Demnach verliere Deutschland einen seiner größten Maler, den die Zeitgenossen zu Recht als den „Horace Vernet de l’Allemagne“ erachteten.
- Note:
- Lexikon der Düsseldorfer Malerschule Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum: Die Poesie (1838)
- Note:
- Paris und die deutsche Malerei 1750 - 1840 Köhler auf Seite 453 1839 Salon (Pariser Ausstellung) "Poesie", Medaille 3. Klasse (Livret Nr. 1146)
- Note:
- Zeitung für die elegante Welt. 38. 1838 Christian Köhler gab eine Poesie, in technischer Beziehung sehr schätzenswert, aber nicht frei von Affektation und viel zu körperlich, sodass sie der Flügel wohl bedurfte. Sie ließ kalt und verdiente nicht das außerordentliche Los, welches ihr von einigen zu Teil wurde. Für dergleichen Darstellungen ist die Behandlung Köhlers nicht geistig genügend. https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10532434?page=1082&q=%28%22Christian+K%C3%B6hler%22%29
Informationen
- Catalog ID
-
e62c0790-7904-11ef-8ce8-63d8e2607d6f
[Permalink] - Object ID
- CK-38-02
- Künstler
- Christian Köhler
- Datierung
- 1838
- Bildgröße
- 195 cm × 135 cm
Weitere Bilder

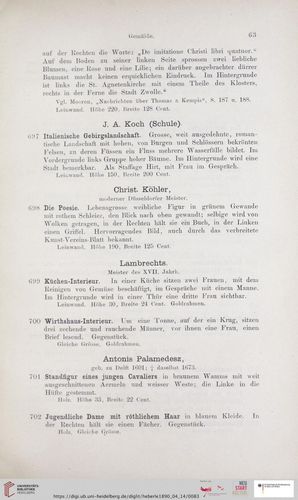


Web Links
Medien
4 Bild(er) verfügbar