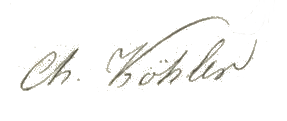Hagar und Ismael (1. Fassung)

Hagar und Ismael
Stiftung Museum Kunstpalast 2024, ausgestellt in Raum 010.2
Beschreibung
Provenienz:
1844 ausgestellt auf der Ausstellung des "Kunst-Vereins für die Rheinlande und Westphalen"
1845 Schenkung des "Kunst-Vereins für die Rheinlande und Westphalen" an die Stadt Düsseldorf zur Gründung einer neuen Gemäldegalerie
Städt. Gem.-Samml. Düsseldorf
Düsseldorf, Kunstpalast
Ausstellungen:
1844, Düsseldorf, Galeriesaal der Akademie
Quellenhinweise
Becker & Thieme: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler (1927)
Düsseldorf, Städt. Kunstmus.: Hagar u. Ismael, 1844 (Verz. Städt. Gemälde Sammlung 1913)
Düsseldorfer Künstler aus den letzten fünfundzwanzig Jahren: kunstgeschichtliche Briefe (1854)
Eine Susanne im Bade und eine Hagar mit dem verschmachtenden Ismael sind in der Komposition weniger ausgezeichnet und wohl nur vom Künstler zur Darstellung gewählt, um seinem großen Farbentalent zu dienen, zumal da gerade diese Gegenstände so unendlich oft behandelt worden sind, dass man ihrer nachgerade müde ist.
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte (1895)
Hagar u. Ismael. Sie hält den Knaben auf dem Schos und blickt, Rettung suchend, zum Himmel empor. Bez: Ch. Köhler 1844. h. 1,37, br. 1,05. E: Städt. Gem.-Samml. Düsseldorf, Geschenk des KV f. Rh. u. W. 1845. Gest. von J. Felsing 1848. gr. fol. – Ddf. KA., Sommer 44; Köln, 2. allg. d. u. hist. KA. 61.
Europa : Chronik der gebildeten Welt. 1861,[1]
Eine „Susanna im Bade“ und eine „Hagar mit Ismael in der Wüste“ sind in der Komposition weniger ausgezeichnet, dagegen ebenfalls Belege des großen Farbentalentes, welches Köhler sein eigen nannte.
Die Königliche Kunst-Akademie zu D.: ihre Gesch., Einrichtung und Wirksamkeit und die D. Künstler (1856)
„Hagar und Ismael“ (1844), vom Kunstverein für Rheinland und Westphalen der städtischen Galerie zu Düsseldorf geschenkt
Cataloging Note
Künstler
Christian Köhler, Werben 1809–1861 Montpellier
Öl auf Leinwand
Maße ohne Rahmen134,5 × 109,5 cm
Maße mit Rahmen173 × 152 cm
Statusausgestellt, Raum 010.2
Über das Werk
Christian Köhler war einer der Schüler, die dem Düsseldorfer Akademie-Direktor Wilhelm Schadow von Berlin an den Rhein gefolgt waren und zum Kern der Düsseldorfer Malerschule zählten. Das vorliegende Werk ist ein Beispiel für die sogenannte Seelenmalerei, für welche die Düsseldorfer international bekannt wurden. Sie rückten das Gefühlsleben der Dargestellten ins Zentrum und vernachlässigten die literarischen Hintergründe ihrer Motive, in diesem Fall die biblische Geschichte der verstoßenen ägyptischen Sklavin Hagar, die mit ihrem Sohn Ismael durch die Wüste irrt.
ErwerbungSchenkung 1845
Provenienz
[...]; 1844 ausgestellt auf der Ausstellung des "Kunst-Vereins für die Rheinlande und Westphalen"; spät. 1845 "Verein zur Errichtung einer
Gemälde-Gallerie zu Düsseldorf" erworben durch Schenkung des "Kunst-Vereins für die Rheinlande und Westphalen" zur Gründung einer neuen Gemäldegalerie
InventarnummerM 4067
Kontaktsammlung@kunstpalast.de
https://sammlung.kunstpalast.de/objects/142154/hagar-und-ismael
Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819 – 1918 (2011) von Baumgärtel, Bettina
Schon der 1829 gegründete Kunstverein für die Rheinlande und Westphalen machte es sich zur Aufgabe, die Gründung der Gemäldegalerie durch Schenkungen zu befördern. Dem Verein gelang es, Hauptwerke der Düsseldorfer Malerschule wie A. Baurs Christliche Märtyrer aus der römischen Kaiserzeit (Abb. 2), Ch. Köhlers Hagar und Ismael (Kat. Nr. 20), C. F. Lessings Die Belagerung (Kat. Nr. 155), T. Mintrops großformatige Heilige Familie (Kat. Nr. 81) oder C. F. Sohns Tasso und die beiden Leonoren (Kat. Nr. 70) direkt aus den Ateliers der Künstler für die zu gründende Gemäldegalerie zu sichern. 1852 wurde sogar ein Wettbewerb zur Ergänzung der Galerie ausgeschrieben, den Wilhelm Sohn mit seinem Erstlingswerk Jesus und die Jünger auf dem stürmischen Meer (Abb. 3) gewann.
Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819 – 1918 (2011) von Baumgärtel, Bettina
Hagar und Ismael, 1844
Öl auf Leinwand, 134,5 x 109,5 x 3,5 cm
Sign. u. dat. u. r.: Ch. Köhler. 1844.
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, Inv. Nr. M 4067
Prov.: wohl 1844 auf der Ausstellung des KVRW erworben ohne Verwendungszweck; 1845 Geschenk des KVRW an die Stadt Düsseldorf zur Gründung einer neuen Gemäldegalerie
Nachstich von Georg Jacob Felsing, 1848
Replik: sign. u. dat. 1847, Öl/Lw., 134,5 x 110 cm, Stiftung Sammlung Volmer, Wuppertal
Ausst.: 1844 Düsseldorf, Galeriesaal der Akademie
Lit.: Müller v. Königswinter 1854, S. 36; Wiegmann 1856, S. 143; Schaarschmidt 1909, S. 68 (Nr. 19); BK Düsseldorf 1969, S. 184-185, Abb. 98; Trier/Weyres 1979-81, Bd. 3, S. 102, 109, Abb. 50, S. 102; AK Düsseldorf 1999, S. 87 (m. Abb.); Biedermann 2001, S. 130, Kat. Nr. 36
Köhler wurde als Pferdeknecht des Schriftstellers K. G. S. Heun mit W. v. Schadow bekannt, der ihn an die Akademie holte, wo er bald sein Meisterschüler wurde. 1843/44 gemalt im Auftrag des Düsseldorfer Kunstvereins erscheint Köhlers Gemälde an zentraler Stelle auf der Galeriewand von Bosers Bilderschau (Kat. Nr. 18), ist allerdings noch nicht in der Studie zur Bilderschau wiedergegeben, die im Zentrum von Bosers 26er-Gruppenbildnis gezeigt wird (Abb. 10).
Köhlers Figur steht in der Tradition heroisch-biblischer Frauengestalten der italienischen Malerei, besonders Renis und Raffaels. Der Kopf mit dem himmelnden Blick ist Renis Himmelfahrt Mariae der Münchner Pinakothek entnommen. Mit dieser Mutter-Kindgruppe folgte Köhler der allgemeinen Tendenz der Malerschule zur Seelenmalerei im gesteigerten Sentiment, das in theatralischer Pose vorgetragen und durch den Schmelz des feinen Kolorits noch gesteigert wird. Köhlers Gemälde könnte das erste Werk gewesen sein, das noch vor Gründung des Vereins zur Errichtung einer Gemäldegalerie zu Düsseldorf erworben wurde, dessen Sammlung 1913 zur Gründung der Städtischen Kunstsammlungen führte.
Erst kürzlich tauchte die drei Jahre später wohl im Auftrag der niederländischen Prinzessin Marianne von Oranien-Nassau entstandene Zweitfassung im Handel auf. Die mit Prinz Albrecht von Preußen verheiratete Prinzessin der Niederlande und von Preußen besaß eine Sammlung von über 600 Gemälden, die sich auf Schloss Reinhartshausen befanden. Ein Teil des Oranien-Nassau Besitzes ging in den Queen Juliana of the Netherlands Estate über.
Köhlers Werk fand zahlreiche Nachfolger; neben Carl Gottfried Eybes Hagar und Ismael von 1845 (Stiftung Sammlung Volmer) auch in Wittigs mehr zur Pietà christianisierten Gruppe (Kat. Nr. 19).
Informationen
- Catalog ID
-
6c5c9fc0-790d-11ef-8ce8-63d8e2607d6f
[Permalink] - Object ID
- CK-44-01
- Künstler
- Christian Köhler
- Datierung
- 1844
- Bildgröße
- 137 cm × 105 cm
Weitere Bilder

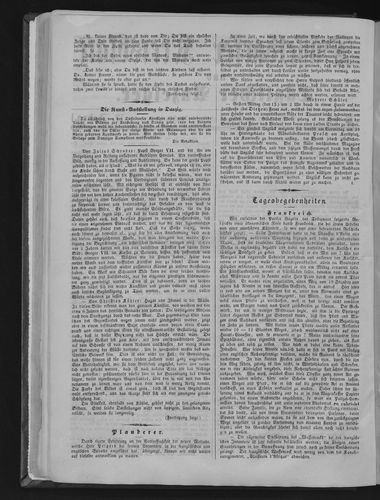
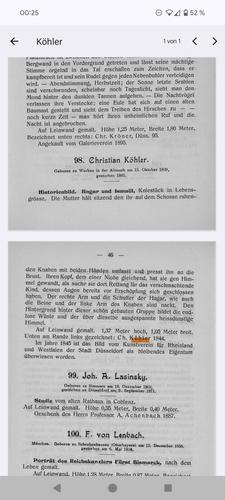
Web Links
Medien
3 Bild(er) verfügbar